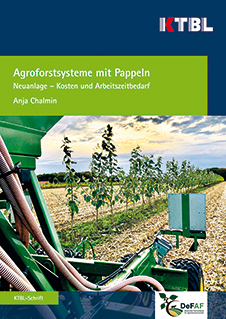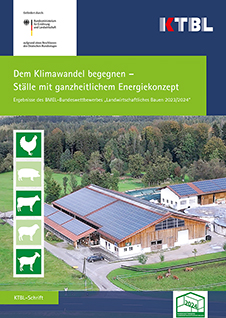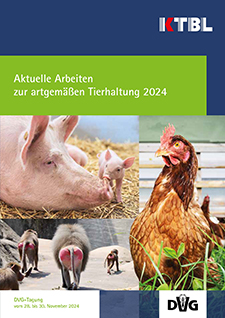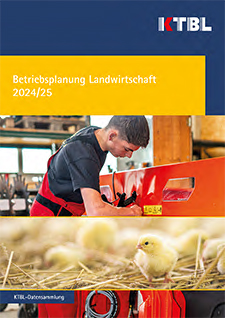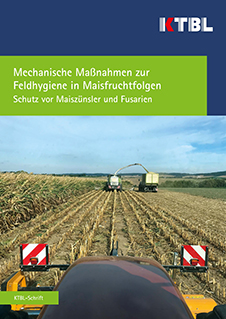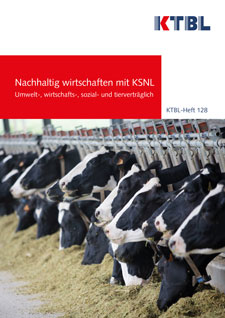Weiterbetrieb von Photovoltaikanlagen
Ab 2021 werden die ersten Betreiber von Photovoltaikanlagen (PV‐Anlagen) keine Förderung nach dem Erneuerbaren‐Energien‐Gesetz (EEG) mehr erhalten. Der vom Gesetzgeber festgelegte Förderzeitraum von 20 Jahren läuft aus. Da viele Anlagen technisch weiterhin in der Lage sind, Strom zu erzeugen, streben die meisten Anlagenbetreiber einen Weiterbetrieb mit oder ohne Eigenverbrauch an. Wesentliche Hürde ist, dass Netzbetreiber nicht verpflichtet sind, den überzähligen, nicht eigenverbrauchten Strom abzunehmen und zu vergüten. Es gibt weder einen Anspruch auf Zahlung eines Marktpreises bzw. einer Einspeisevergütung noch ein eindeutiges Recht auf Abnahme des Solarstroms.
Immerhin sind die Anlagenbetreiber berechtigt, den Strom weiter einzuspeisen, wenn sie für die jeweilige Strommenge einen konkreten Abnehmer benennen (sonstige Direktvermarktung). Für eine solche Direktvermarktung ist allerdings die Zusammenarbeit mit einem Vermarktungspartner nötig, da die Anforderungen für die Teilnahme am Stromhandel für einzelne Anlagenbetreiber kaum zu erfüllen sind. Die Direktvermarktung für kleine und mittelgroße PV-Anlagen ist ein Novum, sodass entsprechende Angebote derzeit erst in der Entwicklung sind.
Wirtschaftlichkeit
Abgesehen vom nötigen rechtlichen und organisatorischen Rahmen soll der Weiterbetrieb der Anlagen natürlich auch wirtschaftlich sein. Auch wenn die Anlage abgeschrieben ist, werden durch den Weiterbetrieb Kosten verursacht. Neben den Ausgaben für Versicherung, Wartung, Reparatur und Stromzähler sind die Vermarktungskosten und ggf. Umrüstkosten zu tragen. Letztere werden verursacht durch notwendige Umrüstungen (z. B. zusätzliche Zähler für den Eigenverbrauch) und eine Anlagenüberprüfung.
Auf der Erlösseite ist zu unterscheiden, ob der Strom selbst verbraucht oder ins Netz eingespeist wird. Für den eigenverbrauchten Solarstrom muss nach Ablauf der Vergütungsdauer 40 % der EEG‐Umlage an den Netzbetreiber entrichtet werden. Als spezifischer Erlös kann somit durch den vermiedenen Zukauf der Strompreis abzüglich der anteiligen Umlage angenommen werden (z. B. 27 ct/kWh – 2,7 ct/kWh = 24,3 ct/kWh). Für den eingespeisten Strom wird der Erlös nach derzeitigen Bedingungen in der Größenordnung des Marktpreises in Höhe von ca. 4-6 ct/kWh liegen. Während die Einsparungen aus dem Eigenverbrauch auch bei kleineren Anlagen ausreichen, um die laufenden Kosten zu decken, sind die Einnahmen aus der Einspeisung ins Netz nur bei größeren Anlagen (z.B. 30 kWp) kostendeckend. Für kleinere Anlagen entscheidet somit der mögliche Eigenverbrauchsanteil über die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Weiterbetriebs. Der Eigenverbrauch lässt sich nur in gewissen Grenzen steuern, indem der Verbrauch in die Erzeugungszeiten verschoben wird. Eine weitere Möglichkeit ist die Speicherung des Stroms. Die dadurch entstehenden Kosten führen zusammen mit den Stromgestehungskosten der PV-Anlage aber insbesondere bei kleinen Anlagen zu Stromkosten für den zusätzlichen Eigenverbrauch, die oberhalb der Zukaufspreise liegen.
Die Tabelle zeigt die zu erwartenden Kosten und Erlöse für den Weiterbetrieb dreier beispielhafter PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 2 kWp, 5 kWp und 30 kWp. Es zeigt sich, dass durch den Weiterbetrieb der kleinsten Anlage bei den gegebenen Annahmen sowohl bei Volleinspeisung als auch bei einem Eigenverbrauch in Höhe von 40 % ein Verlust entsteht. Die 5-kWp-Anlage kommt beim angenommenen Eigenverbrauch knapp in die Gewinnzone. Nur bei der großen Anlage wäre sowohl die Einspeisung als auch der Eigenverbrauch wirtschaftlich.
Wirtschaftlichkeit des Weiterbetriebs von PV-Anlagen am Beispiel dreier Anlagengrößen (Annahmen: Ertrag 900 kWh/kWp; Vermarktungskosten fallen unabhängig vom Anteil Eigenverbrauch an, erzielbarer Marktpreis bei Einspeisung 5 ct/kWh.)
| Anlagengröße der Modelle in kWp | |||
| 2 | 5 | 30 | |
| Ertrag in kWh/a | 1.800 | 4.500 | 27.000 |
| Kosten | |||
| Versicherung in €/a | 50 | 75 | 200 |
| Wartung/Reparatur in €/a | 50 | 120 | 450 |
| Zählerkosten in €/a | 40 | 40 | 135 |
| Vermarktungskosten in ct/kWh in €/a | 4,6 83 | 2,0 90 | 0,5 135 |
| Abschreibung auf einmalige Investitionen (10 a) in €/a | 70 | 70 | 120 |
| Summe Kosten in €/a in ct/kWh | 293 16,3 | 395 8,8 | 1.040 3,9 |
| 100 % Einspeisung | |||
| Marktpreis in ct/kWh | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Einnahmen in €/a | 90 | 225 | 1.350 |
| Gewinn/Verlust in €/a | - 203 | - 170 | 310 |
| Eigenverbrauch | |||
| Preis Stromeinkauf in ct/kWh | 28,0 | 26,0 | 23,0 |
| EEG-Umlage Eigenverbrauch in ct/kWh | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Einsparung Eigenverbrauch in ct/kWh | 25,3 | 23,3 | 20,3 |
| Stromverbrauch in kWh | 3.000 | 4.900 | 40.000 |
| Eigenverbrauchsanteil in % in kWh | 40 720 | 30 1.350 | 30 8.100 |
| Einnahmen inkl. Einsparungen in €/a | 236 | 472 | 2.589 |
| Gewinn/Verlust in €/a | - 57 | 77 | 1.549 |
Dies ist ein Projekt, das im Rahmen des KTBL-Arbeitsprogrammes "Kalkulationsunterlagen" vom KTBL beauftragt wurde. Das Thema wurde von dem Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) bearbeitet und von der Rechtsanwaltskanzlei Gassner, Groth, Siederer und Kollegen (GGSC) juristisch unterstützt.
Die folgende Datei ist nicht barrierefrei.
Das könnte Sie auch interessieren
Energiebedarfsrechner Tierhaltung
Biogas in der Landwirtschaft
Tagungsunterlagen zur Tagung "Mit Energie in die Zukunft – Strom, Wärme und Kraftstoffe in der Landwirtschaft"